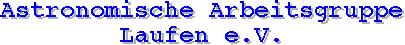
- Astronomie im Berchtesgadener Land -
Der Sternenhimmel im August 2025
![[2508_sternenhimmel_kk.jpg]](2508_sternenhimmel_kk.jpg)
Die abgebildete Sternkarte ist für den 15. August um 23 Uhr Sommerzeit (MESZ) erstellt und bildet den Sternenhimmel entsprechend am Monatsanfang rund eine Stunde später sowie am Monatsende ca. eine Stunde früher ab. Bei M13 handelt es sich um den hellsten Kugelsternhaufen des bei uns sichtbaren Nachthimmels, der ein schönes Feldstecher-Objekt darstellt und unter sehr guten Bedingungen auch ohne optische Hilfsmittel erkennbar ist (wichtig dabei: gute Adaption an die Dunkelheit). Die Andromedagalaxie M31, die lichtstärkste Galaxie am nördlichen Himmel, kann als einzige ihrer Art bei uns mit bloßem Auge gesehen werden. Bzgl. Saturn vgl. den Text. Otto Pilzer
[Zum Vergrößern bitte Bild anklicken]
Der Sommer hat astronomisch seinen Höhepunkt überschritten und die Nächte sind inzwischen um fast zwei Stunden länger als im Juni. Für die Beobachtung der Planeten kann man jedoch schon die Dämmerung nutzen und auch der Mond stört dabei nicht so sehr.
Im Laufe des Monats verlagert sich der Sonnenaufgang von 5:45 auf 6:25, der Sonnenuntergang von 20:44 auf 19:51 (immer MESZ). Vollmond haben wir am 9. und Neumond am 23. August. Günstig für die Beobachtung von Deep-Sky-Objekten sind also vor allem die mondlosen Zeiten der zweiten Monatshälfte; in der übrigen Zeit kann man sich eher auf unser Sonnensystem konzentrieren. Dazu gehört auch der bekannteste Sternschnuppenstrom, die Perseiden. Zudem haben wir in diesem Monat die Gelegenheit, sogar sechs Planeten in den Morgenstunden zu beobachten - vier davon ohne optische Hilfsmittel.
Auf der Sternenkarte wird der Nachthimmel am 15. des Monats um 23 Uhr dargestellt. Um sich am Firmament zu orientieren, sollte man die Karte so halten, dass der Name der Himmelsrichtung, in die man schaut, unten steht. Der Rand der Karte ist dann der Horizont und die Mitte der Karte der Punkt genau über uns (der Zenit). Eine Woche vorher gilt die Karte eine halbe Stunde später, eine Woche später entsprechend eine halbe Stunde früher.
Nach der Abenddämmerung können wir zu Beginn des Monats noch Mars nah am Horizont im Westen finden. Der etwa 1,8 mag helle Planet geht am 1. um 22:20 unter und verfrüht seinen Untergang bis Ende des Monats auf 21 Uhr. Saturn (1 mag) erscheint am 1. August um 22:40 im Osten. Im Laufe des Monats gewinnt er gut 10% an Helligkeit und verschwindet dann um 5 Uhr im Südwesten in der Morgendämmerung. Da die Ringe nur um 3° gegen unsere Blickrichtung geneigt sind, kann man sie erst im Fernrohr wahrnehmen.
Die übrigen Planeten sind Objekte des frühen Morgens. Venus (-3,5 mag) geht am 1. August um 2:40 im Osten auf und um 5:30 verschwindet sie in der Morgendämmerung. Ihr Aufgang verspätet sich im Lauf des Monats um eine Stunde, dabei durchwandert sie die Sternbilder Zwillinge und Krebs. Auf Venus folgt um 3:20 Jupiter (-1,5 mag) in den Zwillingen. Am 12. August um 7:30 wandert Venus in einer Entfernung von nur 52' an Jupiter vorbei. Ab Mitte des Monats taucht am frühen Osthimmel Merkur auf, der schnell an Helligkeit gewinnt und Ende des Monats sogar über -1 mag erreicht. Durch seine Horizontnähe ist er aber schwer zu beobachten. Am 19. befindet sich Merkur (-0,2 mag) in seiner größten scheinbaren westlichen Entfernung (Elongation) von der Sonne: Beide Himmelskörper haben dann einen Winkelabstand von 18°36' zueinander. Dies ist die beste Zeit, um den Merkur zu beobachten, also verpassen Sie diese Gelegenheit nicht!
Für Uranus (6,1 mag) auf der Ekliptik zwischen Hyaden und Plejaden sowie Neptun (7,8 mag) bei Saturn benötigt man ein gutes Fernglas oder ein Fernrohr.
Am 12. August ist wieder das Maximum des Perseiden-Sternschnuppenstroms, des wohl bekanntesten Sternschuppenstroms überhaupt - obwohl die Geminiden im Dezember eine deutlich höhere Fallrate haben. Im August sind aber die Temperaturen angenehmer und im Dezember ist der Himmel häufig bedeckt. Wenige Tage nach dem Vollmond sind die Beobachtungsbedingungen diesmal nicht besonders gut. Die helle Mondscheibe wird den Himmel die ganze Nacht über erleuchten, was die Anzahl der sichtbaren Meteore stark beeinflusst. Eine gute Möglichkeit, diesen Effekt zu reduzieren, ist es, sich im Schatten eines hohen Gebäudes oder eines Baumes vor dem Mondlicht zu verstecken. Die beste Beobachtungszeit sind die Stunden vor der Morgendämmerung.
Die erste überlieferte Beobachtung der Perseiden fand vor etwa zwei Jahrtausenden um 36 v. Chr. in China statt. Bei uns werden die Perseiden auch Tränen des Laurentius genannt, da ihr Erscheinen mit dem Fest des Märtyrers Laurentius am 10. August zusammenfällt - er wurde im Jahre 258 zum Märtyrer. Die Perseiden bestehen aus den Auflösungsprodukten des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Die Erde kreuzt auf ihrer Bahn immer um den 12. August die Staubspur, die dieser Komet im All hinterlassen hat. Die Staubteilchen treffen dabei mit hoher Geschwindigkeit (59 km/s) auf die Atmosphäre und bringen die Luftmoleküle zum Leuchten. Die Sternschnuppe ist daher nicht das verglühende Staubkorn selbst, sondern wird durch das Rekombinationsleuchten der ionisierten Luft sichtbar. Als sogenannte Feuerkugeln können sie sogar die Helligkeit der Venus erreichen. Der Radiant (der scheinbare Ursprung dieses Stroms) liegt im namensgebenden Sternbild Perseus, nahe der Grenze zur Kassiopeia.
Hoch im Süden blicken wir auf das Sommerdreieck, gebildet durch die Sterne Deneb (Schwan), Wega (Leier) und Atair (Adler). Ziemlich genau in der Mitte zwischen ihnen liegt eins der kleinsten und unscheinbarsten Sternbilder: der Pfeil (Sagitta). Es besteht nur aus vier helleren Sternen zwischen 3. und 4. Größe. Schon viele ältere Kulturen sahen es als Pfeil, daher gehört es zu den 48 klassischen Sternbildern, die Ptolemäus beschrieben hat. In der Mitte dieses Sternbilds liegt M 71 (6,1 mag, auch als Anglerfisch-Haufen oder Pfeilspitzen-Haufen bezeichnet), ein Kugelsternhaufen, der mit einem Alter von nur 9 - 10 Milliarden Jahren erstaunlich jung ist.
Gerardo Inhester
Zu den anderen Sternenhimmel-Artikeln
![[AAL]](../pics/aal.gif) Zurück zur Home Page der AAL
Zurück zur Home Page der AAL
Otto J. Pilzer, 2025-08-01