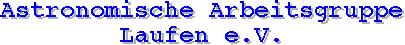
- Astronomie im Berchtesgadener Land -
Der Sternenhimmel im November 2025
![[2511_sternenhimmel_kk.jpg]](2511_sternenhimmel_kk.jpg)
Die abgebildete Sternkarte ist für den 15. November um 21 Uhr MEZ erstellt und zeigt den Sternenhimmel entsprechend am Monatsanfang rund eine Stunde später sowie am Monatsende ca. eine Stunde früher. Bei M13 handelt es sich um den lichtstärksten Kugelsternhaufen am Nordhimmel, bei M42 um den bekannten Orionnebel im "Schwertgehänge" des Sternbilds Orion. Wenn sie hoch genug über dem Horizont stehen (bei M13 nur in den frühen und bei M42 ab den späteren Abendstunden), sind sie schöne Feldstecher-Objekte; M42 ist nach Adaption an die Dunkelheit leicht ohne Hilfsmittel sichtbar, bei M13 gelingt dies nur unter exzellenten Bedingungen. Bzgl. Jupiter, Saturn und M31 vgl. den Text. Otto Pilzer
[Zum Vergrößern bitte Bild anklicken]
In der letzten Oktoberwoche endete die Sommerzeit, deshalb ist auch hier nun wieder alles in MEZ angegeben. Der Herbst schreitet in großen Schritten voran, was auch an der Tageslänge zu erkennen ist. Am 1. November finden wir die Sonne noch fast 10 Stunden über dem Horizont (Aufgang 6:55, Untergang 16:50). Zum Ende des Monats verringert sich die Tageslänge auf 8 h 40 min. Bis zur Wintersonnenwende im Dezember wird sie nur noch eine Viertelstunde kürzer, ehe sie dann wieder zulegt.
Mit Ausnahme von Mars können wir in diesem Monat alle Planeten unseres Sonnensystems sehen, sogar der flinke Merkur zeigt sich zum Monatsende im Südosten am Morgenhimmel. Der 0,2 mag helle Götterbote geht am 30. kurz vor 6 Uhr auf und kann vielleicht - abhängig vom Morgendunst - eine Viertelstunde später mit einem Fernglas aufgefunden werden, ehe er um etwa 7 Uhr im Morgengrauen verblasst.
Die -4 mag helle Venus, unsere Begleiterin der letzten Monate, verabschiedet sich vom Morgenhimmel. Am 1. wandert sie noch in 4° Abstand nördlich an Spica, dem Hauptstern der Jungfrau, vorbei. Im Laufe des Monats geht sie immer später auf, bis sie ab etwa 25. Nov. (Aufgang 6:30) nur noch schwer zu finden sein wird.
Der Gasriese Jupiter beginnt am 11. seine Oppositionsschleife in den Zwillingen. Er wird leicht rückläufig, bevor er Anfang Januar in Opposition zur Sonne gelangt. Mit etwa -2,5 mag ist er das dominierende Gestirn der Nacht und seine nördliche Position öffnet tolle Blicke auf die Wolkenbänder seiner Atmosphäre. Fernrohrbeobachter bemerken auch das Anwachsen seines Durchmessers, da der Abstand zur Erde jetzt immer geringer wird. Am 15. Nov. geht er um 20:30 Uhr auf, am Monatsanfang etwa eine Stunde später und zum Monatsende eine Stunde früher.
Wo ist Saturns Ring?
Der im Wassermann stehende Saturn beendet dagegen seine Oppositionsperiode zum Ende des Monats. In der ersten Nachthälfte ist der knapp 1 mag helle Ringplanet aber nach wie vor gut zu beobachten. Besonders spektakulär ist momentan jedoch etwas, das man fast nicht mehr sieht - nämlich sein Ring. Die Erde verweilt momentan nahe Saturns Ringebene, so dass wir fast exakt von der Seite auf den generell sehr schmalen Ring schauen. Dieser erscheint uns dadurch unter dem sehr kleinen Öffnungswinkel von nur noch 0,4 Grad. Vom Ring bleibt bestenfalls nur eine dünne Linie übrig und unter weniger optimalen Bedingungen ist er überhaupt nicht mehr zu erkennen.
Der bläuliche Gasriese Uranus kommt am 21. Nov. in Opposition. Mit 5,6 mag ist er zu leuchtschwach, um ihn mit dem freien Auge erkennen zu können. Mit einem Fernglas kann man ihn aber aufspüren - momentan etwa 5° südlich der Plejaden (Siebengestirn).
Im Süden kulminieren gerade die bekannten Herbststernbilder Pegasus und Andromeda. Wo die hellste mit bloßem Auge sichtbare Galaxie M 31 (Andromedanebel, 3,4 mag) zu finden ist, weiß jeder, der diese Rubrik regelmäßig verfolgt. Auch ihre Nachbarin, die 5,7 mag helle Dreiecksgalaxie M 33, hat der eine oder andere vielleicht schon mit dem Fernglas erspäht. Man sucht sich hierfür am besten die spitze Ecke im Sternbild Dreieck und schwenkt dann 4° nach Westen. Eine weitere Möglichkeit wäre, M 31 an der Andromeda-Sternenkette nach Süden zu spiegeln. Auch so träfe man ziemlich genau auf die etwa ein halbes Grad Durchmesser aufweisende Dreiecksgalaxie. Im direkten Vergleich zu M 31 ist M 33 aber schon eine kleine Herausforderung, die einen klaren dunklen Himmel erfordert. Aber solche Nächte gibt es im Herbst immer wieder und zudem stehen beide Galaxien momentan senkrecht über uns in optimaler Position.
Wer im Sommer keine Gelegenheit fand, einen Blick auf den Kugelsternhaufen M 15 zu werfen, kann das jetzt noch nachholen. Um 19 Uhr, wenn es dunkel ist, hat er gerade den Südmeridian überschritten. Mit dem Fernglas findet man ihn recht einfach, indem man sich eine Sternkette entlang hangelt. Beginnend beim rechten unteren Stern des Pegasus-Quadrats hüpft man in ca. 8°-Schritten zwei Sterne Richtung WSW und dann einen weiteren Stern nach NW. Dieser Zielstern trägt den Namen Enif. Zwischen Enif und dem nördlichen Sternpärchen der unscheinbaren Konstellation Füllen ist M 15 zu finden. Im Fernglas erscheint er als recht kleiner (Durchmesser 6') aber heller (6,0 mag) Lichtfleck und ist durchaus mit dem bekannten Kugelsternhaufen M 13 (8', 5,7 mag) im Sternbild Herkules vergleichbar. Im 4-Zoll-Teleskop löst sich der Rand in Einzelsterne auf.
Der bekannte Sternschnuppenstrom der Leoniden ist in den Morgenstunden der zweiten Novemberhälfte aktiv (Radiant 10° nördlich von Regulus). Am 17. ist das Maximum zu erwarten, wobei die Fallrate eher nicht zweistellig werden wird. Aber zumindest stört der Mond kaum, da wir am 20. Neumond haben. Am 21. Nov. könnten auch Exemplare der Alpha-Monocerotiden hinzukommen. Vom Vollmond stark beeinträchtig werden dagegen die Tauriden im Zeitraum 5. bis 10. November. Trotzdem könnten sie spannend sein, da immer wieder recht helle Meteore und sogar Feuerkugeln dabei sind. Zudem wurde für dieses Jahr eine Häufung prognostiziert. Viel Glück dabei!
Bernhard Kindermann
Zu den anderen Sternenhimmel-Artikeln
![[AAL]](../pics/aal.gif) Zurück zur Home Page der AAL
Zurück zur Home Page der AAL
Otto J. Pilzer, 2025-11-01